C032 Das 140-1600 Wolter Scope Schiefspiegler
3. März 2004
Am 13. Juni 2003 jährte sich der 100. Geburtstag von Anton Kutter (1903-1985).
[http://www.astronomie.de/bibliothek/artikel/geschichte/kutter/] Wolfgang Steinige, Freiburg, nahm dieses
Datum zum Anlaß, den Begründer der "Schiefspiegler-Szene" selbst und eine ganze Reihe anderer ähnlicher
opt. Systeme zu würdigen. Neben dem Yolo-Schiefspiegler, der von dem amerikanischen Optik-Professor
Arthur Leonard entworfen wurde, sind derzeit zwei interessante Neuentwicklungen von größerem Interesse,
dem Herrig Kompakt Schiefspiegler, ein Teleskop, das mit zwei Spiegeln auskommt und dem Wolter Scope,
das drei Spiegel benutzt. (Die Entwicklung verfolge ich seit etwa 10 Jahren im Zusammenhang mit dem
1993 von Jose&Leticia Sasian entwickelten Strahlendurchstoß-Programm TCT, das unter DOS lief, und
dem von David Stevick 1998 entwickelten Spotplot für den gleichen Zweck, bis ich mich schließlich zur
Anschaffung von ZEMAX entschied.)
Für beide neueren Systeme gibt es vielversprechende Proto-Typen, die der Verfasser bereits beide testen
konnte. Weil es aber besonders bei Schiefspieglern um opt. und mechanische Feinheiten geht verlief die
Diskussion zunächst über mehrere Jahre intern, wobei die Frage, ob daraus dem Vollapochromaten als
LinsenFernrohr ein ernstzunehmender Konkurrent erwachsen könnte uns am allerwenigsten interessiert.
Das "kleine" 140/1600 Wolter Scope, das ich unlängst vor dem Planspiegel hatte, ist also nicht nur von der
Bauweise kompakt und handlich, sondern auch hinisichtlich seiner Leistung eine interessante Alternative
zu gängigen vollapochromatischen Refraktor Systemen. Weil ich grundsätzlich vor allen Tests den Justier-
zustand überprüfe, hatten wir es zunächst mit dem typ. System-Fehler "Astigmatismus" zu tun, der ent-
steht, wenn das Wolter Scope nicht sauber justiert ist. (Zusammen mit dem Designer Dr. Heino Wolter
eine Sache von ca. 30 Minuten) Dies ist deswegen wichtig, weil sonst die quantitative Auswertung die
tatsächliche opt. Leistung dieses Systems falsch wiedergibt. Mit dem Auswertprogramm FringeXP ist
es möglich, aus einem vorhandenen Interferogramm sowohl Koma- wie Astigmatismus-Verformungen
herauszurechnen, was mit meiner Auswertsoftware nicht möglich ist.
Das "kleine" 140/1600 Wolter Scope

Am Sucherfernrohr erkennt man, in welche Richtung der Beobachter eigentlich schaut.
Sein Innenleben kann man auf dem nächsten Foto studieren:

Der Strahlengang ist auf dieser Schema Zeichnung erkennbar:
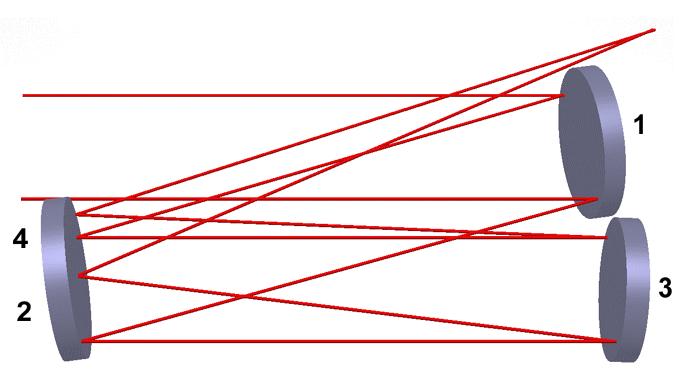
Bereits beim Ronchi-Gitter-Test 13lp/mm in Autokollimation konnte man den schräg liegenden Justier-
Astigmatismus sehr deutlich intra/extrafokal erkennen und damit herausjustieren, natürlich auch mit dem
Sterntest unter hoher Vergrößerung. Den Justier-Astigmatismus erkennt man mit dem Ronchi-Gitter
jedoch nur, wenn er schräg zu den Gitterlinien liegt.
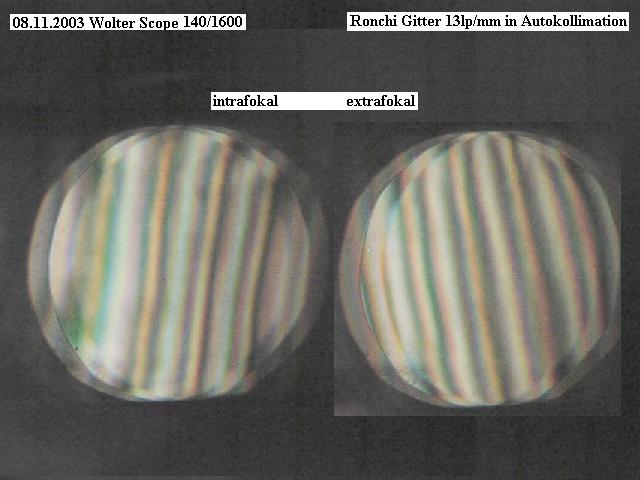
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Vergleich mit einem ähnlichen großen Voll-Apochromaten
hoher Qualität. Der Vergleich findet sinnvollerweise bei ca. 550 nm statt. Dabei zeigt sich beim APO
eine leichte Überkorrektur, das WolterScope ist leicht unterkorrigiert, was bei diesem System sogar ein
Vorteil sein könnte, owwohl die Spiegel aus Sital sind.
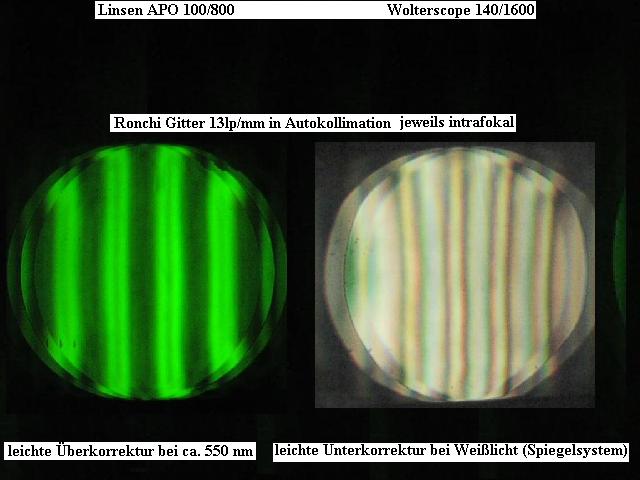
Im Phasenkontrast-Test zeigt sich der Linsen-Typ einmalig glatt (links), während man beim WolterScope
auf ein Spiegelsystem schließen kann. Dabei kommt beim WolterScope erschwerend hinzu, daß der mittlere
Konvex-Spiegel zweimal benutzt wird, also an die Politur dieses Systems die allerhöchsten Ansprüche ge-
stellt werden müssen. Die leichte Schattierung auf dem rechten Bild muß man meinem SpaltWinkel an-
lasten. Auch die Vignettierung auf der rechten Seite hängt damit zusammen, daß ich nicht ganz exakt auf
der Achse prüfte. Sie wird über Blend-Bögen verursacht und ist im übrigen herausnehmbar.

Bei der Auswertung meines Programmes läßt sich Koma und Astigmatismus nicht selektiv aus einem
Interferogramm herausrechnen. Weil dies aber mit dem FringeXP Auswert Programm möglich ist, stelle
ich die quantitativen Ergebnisse damit dar. Wäre also das WolterScope ganz exakt justiert, was bei einer
Prüfzeit von nur 3 Stunden ein fast unüberwindliches Hindernis ist, wenn einem das System nicht vertraut
ist, dann würde bei exaktem Testaufbau ein Strehl von 0.97 herauskommen. Weil man aber dem Interfero-
gramm sowohl die Restkoma, wie den vorhandenen Justier-Astigmatismus noch deutlich ansieht, verbleibt
für diesen Fall ein Strehlwert von 0.905, wenn man die Koma abgezogen hat. Und dieses Ergebnis ist
sehr beachtlich.
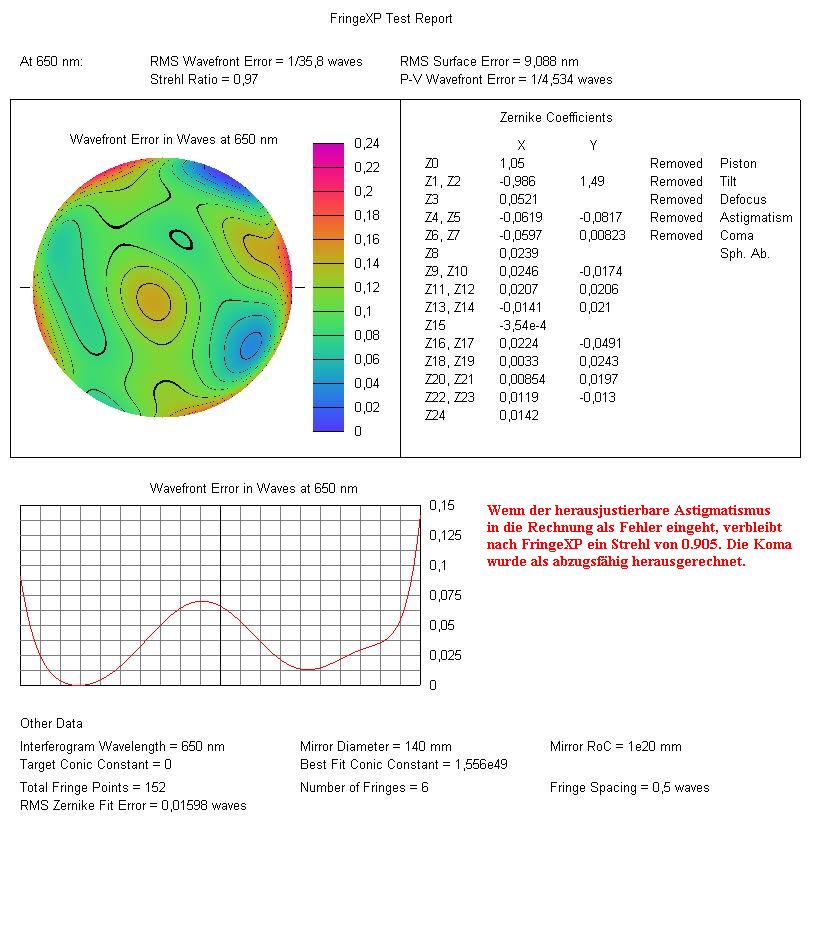
Das wäre das fragliche Interferogramm bei 650 nm
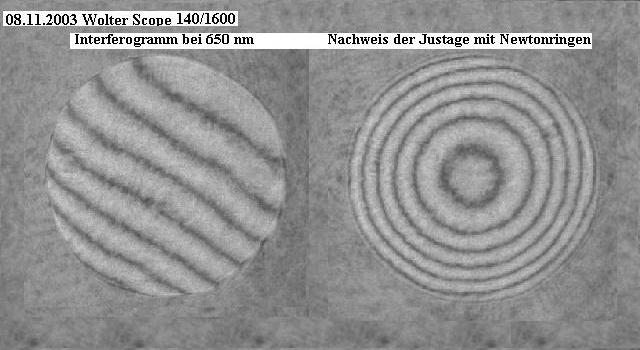
Damit läßt sich der Justierzustand des Wolter SCope dokumentieren, fast perfekt aus Zeitgründen.
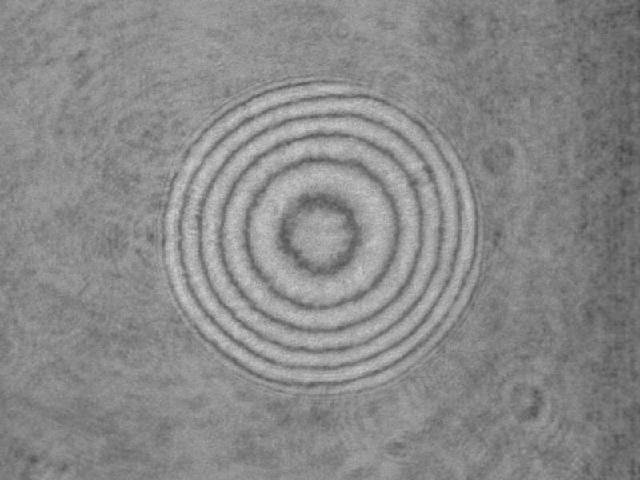
Als Prüfer von Optiken, bin ich weder für Werbung, für Verkauf und für die Konkurrenz-Situation
auf dem Markt zuständig und käme nie auf die Idee, mich dafür zu interessieren. Ich weiß also
weder, wer das Gerät vertreibt, was es kostet und wem es Konkurrenz machen könnte. Das ergibt
sich allenfalls aus Euren Antworten.
Opt. Grüße
Wolfgang Rohr
Webadressen zur Information
http://www.aokswiss.ch/d/tel/kutter.html
http://www.binoviewer.at/testberichte/150mmWolterscope.htm
http://www.astronomie.de/technik/teleskop-...r_teleskope.htm